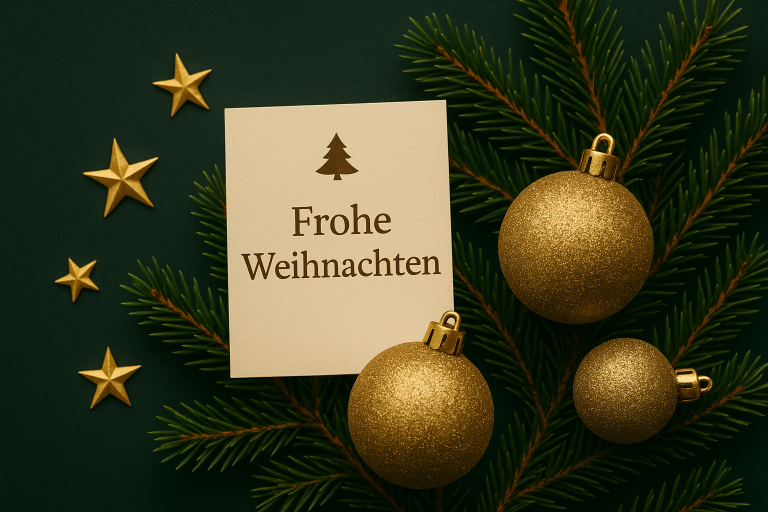Ein interner Datenschutzbeauftragter ist für viele Unternehmen ein zentraler Bestandteil der Datenschutzorganisation. Mit Art. 37 Abs. 6 DSGVO steht es Unternehmen frei, einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu benennen. In Deutschland ist die interne Lösung besonders verbreitet – auch, weil sie Nähe zu Prozessen und Mitarbeitenden ermöglicht.
Doch wie praktikabel ist der interne DSB im Jahr 2025 wirklich?
Welche Anforderungen gelten an seine Fachkunde, seine Unabhängigkeit – und wie weit reicht seine Haftung?
Dieser Beitrag beleuchtet die Chancen, Herausforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen für interne Datenschutzbeauftragte im Lichte der DSGVO und des BDSG.
Voraussetzungen für die interne Bestellung
Die interne Bestellung eines DSB setzt voraus, dass die benannte Person Fachkunde und Zuverlässigkeit im Sinne des Art. 37 Abs. 5 DSGVO besitzt.
In der Praxis mangelt es häufig an tiefer datenschutzrechtlicher und technischer Erfahrung, weshalb Unternehmen eine sorgfältige Eignungsprüfung durchführen sollten.
Wichtige Anforderungen:
- Nachweisbare Fachkenntnis in Datenschutzrecht und IT-Sicherheit
- Regelmäßige Fort- und Weiterbildung (Art. 38 Abs. 2 DSGVO)
- Organisatorische Freistellung von anderen Aufgaben
- Klare Regelung der Weisungsfreiheit
- Sicherstellung ausreichender Ressourcen (Zeit, Budget, Tools)
Ein Zertifikat allein belegt keine praktische Kompetenz. Entscheidend ist die kontinuierliche Fortbildung und die arbeitsvertragliche Absicherung, dass der DSB seine Aufgaben konfliktfrei erfüllen kann.
In Betrieben mit Betriebsrat ist zusätzlich zu prüfen, ob die Bestellung oder Versetzung des internen DSB mitbestimmungspflichtig ist.
Vorteile und Nachteile eines internen Datenschutzbeauftragten
Die Entscheidung für ein internes Modell bringt klare Vorteile, aber auch strukturelle Risiken mit sich.
Vorteile:
- Tiefe Kenntnis interner Abläufe und Prozesse
- Kein Know-how-Transfer an externe Dritte
- Direkte Einbindung in operative Entscheidungen
- Schnellere Reaktionszeiten bei Datenschutzvorfällen
- Geringere laufende Kosten bei kleinen Organisationen
- Aufbau internen Datenschutz-Know-hows
Nachteile:
- Hoher Schulungsbedarf, insbesondere zu Beginn
- Gefahr von Interessenkonflikten bei Mehrfachrollen
- Weisungsfreiheit organisatorisch schwer durchzusetzen
- Begrenzte Ressourcen bei Teilzeitlösungen
- Fehlender externer Blick auf etablierte Strukturen
Ein individuelles Abwägungsverfahren ist daher unerlässlich: Größe, Komplexität, Risikoprofil und Unternehmenskultur bestimmen, ob ein interner Datenschutzbeauftragter die bessere Wahl ist.
Haftung des internen Datenschutzbeauftragten
Die Haftung interner Datenschutzbeauftragter ist ein häufig unterschätztes Thema.
Grundsätzlich gilt: Der interne DSB ist nicht selbst verantwortlich für Datenschutzverstöße, kann aber im Innenverhältnis haftbar gemacht werden.
Keine unmittelbare Haftung nach Art. 82, 83 DSGVO
Anders als Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter ist der interne Datenschutzbeauftragte nicht Adressat von Bußgeldern oder Schadensersatzansprüchen.
Er trifft keine Entscheidungen über Zwecke oder Mittel der Verarbeitung und gilt somit nicht als Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO.
Nur in Ausnahmefällen – etwa bei einem Mitarbeiterexzess (eigenmächtiges Handeln aus persönlichen Motiven) – kann eine persönliche Haftung denkbar sein.
Vertragliche Haftung gegenüber dem Arbeitgeber
Im Innenverhältnis richtet sich die Haftung des internen DSB nach Arbeitsrecht (§§ 280 ff. BGB i.V.m. § 611a BGB).
Pflichtverletzungen können sich z. B. ergeben durch:
- fehlerhafte Beratung oder Auskünfte,
- unzureichende Kontrolle oder Schulung,
- mangelnde Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde.
Maßstab ist der innerbetriebliche Schadensausgleich:
- Einfache Fahrlässigkeit: keine Haftung
- Mittlere Fahrlässigkeit: anteilige Haftung
- Grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz: volle Haftung
Damit besteht für interne Datenschutzbeauftragte ein deutliches Haftungsprivileg, solange sie sorgfältig handeln.
Deliktische Haftung
Eine deliktische Haftung nach §§ 823 Abs. 1, 2 BGB i.V.m. Art. 38 Abs. 4 und 39 DSGVO ist theoretisch möglich, spielt aber in der Praxis kaum eine Rolle.
Die Hürden für Kausalität und Verschulden sind hoch, und die DSGVO sieht keine Beweislastumkehr zugunsten Betroffener vor.
Besondere Haftung im öffentlichen Dienst
Für Datenschutzbeauftragte im öffentlichen Dienst gelten Sonderregeln:
Nach § 75 BBG bzw. § 48 BeamtStG haften sie gegenüber dem Dienstherrn nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Eine deliktische Haftung ist ausgeschlossen.
Bußgelder richten sich ausschließlich gegen die Behörde, soweit diese als Marktteilnehmer auftritt (§ 43 Abs. 3 BDSG).
Praktische Empfehlungen für interne Datenschutzbeauftragte
Damit Haftungsrisiken minimiert und Compliance-Anforderungen erfüllt werden, sollten Unternehmen und interne DSB folgende Punkte beachten:
- Rollen- und Aufgabenbeschreibung schriftlich fixieren
→ klare Abgrenzung zu anderen Funktionen (z. B. IT-Leitung, HR). - Schulungs- und Fortbildungsplan festlegen
→ regelmäßige Qualifikationsnachweise sichern. - Dokumentation aller Empfehlungen und Prüfungen
→ Nachweis der ordnungsgemäßen Pflichterfüllung. - Weisungsfreiheit organisatorisch absichern
→ direkte Berichtslinie an die Geschäftsführung. - Ressourcen und Zeit klar definieren
→ insbesondere bei Teilzeit- oder Doppelfunktionen. - Interne Kommunikation fördern
→ Datenschutz als strategisches Thema positionieren, nicht als Pflichtübung.
Fazit: Interner Datenschutzbeauftragter als strategischer Erfolgsfaktor
Der interne Datenschutzbeauftragte ist weit mehr als ein formales Compliance-Instrument.
Er kann Datenschutzkultur und Prozessqualität entscheidend prägen – vorausgesetzt, Unternehmen investieren in Qualifikation, Unabhängigkeit und klare Zuständigkeiten.
Die interne Lösung bietet Vorteile bei Vertrautheit und Kosten, erfordert aber organisatorische Disziplin und klare Haftungsstrukturen.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, schafft rechtliche Sicherheit und Vertrauen bei Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.
FAQ: Interner Datenschutzbeauftragter
Wann muss ein interner Datenschutzbeauftragter bestellt werden?
Wenn mindestens 20 Personen regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten oder besondere Datenkategorien betroffen sind (§ 38 BDSG).
Welche Qualifikation braucht ein interner DSB?
Fachkunde in Datenschutzrecht und IT-Sicherheit, regelmäßige Schulungen und nachweisbare Erfahrung im Umgang mit personenbezogenen Daten.
Wie haftet ein interner Datenschutzbeauftragter?
Er haftet nur im Innenverhältnis – und in der Regel nicht bei einfacher Fahrlässigkeit. Die Hauptverantwortung trägt das Unternehmen.
Darf ein interner DSB andere Aufgaben übernehmen?
Ja, aber nur, wenn keine Interessenkonflikte bestehen (Art. 38 Abs. 6 DSGVO).
Praxistipp
Ein interner Datenschutzbeauftragter kann nur erfolgreich arbeiten, wenn seine Empfehlungen dokumentiert und ernst genommen werden.
Mit PLANIT // PRIMA lassen sich Datenschutz-Dokumentationen schnell, revisionssicher und effizient umsetzen.
Jetzt 14 Tage kostenlos testen!