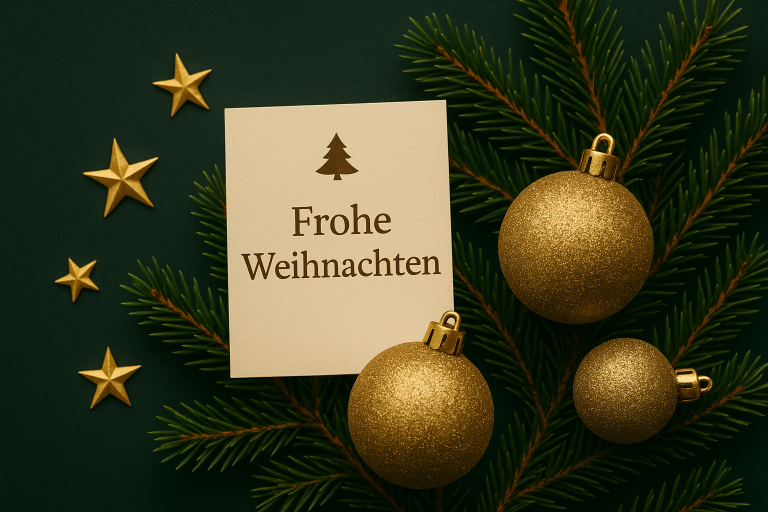In Zeiten zunehmender Digitalisierung und verschärfter Datenschutzgesetze ist Datenschutz im Unternehmen längst mehr als eine juristische Pflicht.
Er ist ein strategisches Thema, das Vertrauen bei Kunden, Partnern und Mitarbeitenden schafft – und gleichzeitig vor empfindlichen Bußgeldern schützt.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei der oder die Datenschutzbeauftragte (DSB).
Doch wann besteht die Pflicht zur Bestellung, welche Aufgaben umfasst die Rolle – und welche Fehler sollten Unternehmen vermeiden?
In diesem Beitrag erfahren Sie kompakt und praxisnah, was die Artikel 37 bis 39 DSGVO für Ihre Organisation bedeuten.
1. Wann ist ein Datenschutzbeauftragter Pflicht? (Art. 37 DSGVO)
Nicht jedes Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten benennen – aber viele sind verpflichtet, ohne es zu wissen.
Ein Datenschutzbeauftragter ist nach Artikel 37 DSGVO erforderlich, wenn im Unternehmen:
- eine umfangreiche, regelmäßige und systematische Überwachung von Personen erfolgt, z. B. durch Tracking, Monitoring oder Videoüberwachung,
- besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden – etwa Gesundheitsdaten, biometrische Merkmale oder Informationen zur religiösen oder politischen Einstellung,
- oder wenn § 38 BDSG greift:
- Mindestens 20 Personen sind ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt – unabhängig von ihrer Beschäftigungsform.
Praxis-Tipp: Die Pflicht gilt unabhängig von der Rechtsform – also auch für Vereine, Behörden oder kirchliche Einrichtungen.
Selbst wenn keine gesetzliche Verpflichtung besteht, kann die freiwillige Benennung sinnvoll sein – etwa zur besseren Steuerung von Datenschutzrisiken.
Fazit:
Prüfen Sie regelmäßig, ob eine Benennungspflicht besteht.
Mit wachsenden Teams, neuen digitalen Prozessen oder internationalen Datenflüssen kann sich die Pflichtlage schnell ändern.
2. Welche Stellung hat der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen? (Art. 38 DSGVO)
Sobald ein Datenschutzbeauftragter benannt ist, regelt Artikel 38 DSGVO seine rechtliche Stellung.
Im Mittelpunkt steht die Unabhängigkeit des DSB.
- Der oder die Datenschutzbeauftragte darf keine Weisungen bei der Erfüllung der Aufgaben erhalten.
- Eine Benachteiligung oder Abberufung darf nicht erfolgen, nur weil die Tätigkeit dem Unternehmen unbequem ist.
- Der DSB berichtet direkt an die Geschäftsführung – nicht an Abteilungsleiter.
Wichtig:
Der Datenschutzbeauftragte darf keine Interessenkonflikte haben.
Personen, die selbst über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden (z. B. IT-Leitung, Geschäftsführung), sind nicht geeignet.
Auch externe Berater müssen auf Unabhängigkeit achten, wenn sie parallel andere Leistungen erbringen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen verpflichtet, dem DSB die nötigen Ressourcen bereitzustellen: Zeit, Budget, Fortbildungen und Zugang zu allen relevanten Informationen.
Nur so kann Datenschutz wirksam umgesetzt werden.
3. Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (Art. 39 DSGVO)
Der Datenschutzbeauftragte ist kein bloßer Prüfer – er ist Berater, Kontrollinstanz und Ansprechpartner zugleich.
Nach Artikel 39 DSGVO ergeben sich fünf zentrale Aufgaben:
1. Unterrichtung und Beratung
→ Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden sowie Beratung der Geschäftsleitung zu allen Datenschutzpflichten.
2. Überwachung der Einhaltung
→ Regelmäßige Audits, Kontrolle technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOMs), Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen.
3. Beratung bei Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA)
→ Unterstützung bei der Bewertung von Risiken und Methodik.
4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
→ Ansprechpartner bei Anfragen, Audits oder Datenschutzvorfällen.
5. Anlaufstelle für betroffene Personen
→ Bearbeitung von Auskunftsersuchen, Beschwerden oder Löschanträgen.
Kurz gesagt:
Der Datenschutzbeauftragte ist ein zentrales Element im Risikomanagement.
Er trifft keine Entscheidungen, sondern identifiziert Risiken, zeigt Alternativen auf und unterstützt bei datenschutzkonformen Lösungen.
4. Häufige Umsetzungsfehler im Datenschutz
Trotz klarer Vorgaben machen viele Unternehmen ähnliche Fehler – oft mit rechtlichen Konsequenzen.
Typische Fallstricke:
- Fehlende oder falsche Benennung eines DSB (z. B. IT-Leiter = Interessenkonflikt)
- Unzureichende Ausstattung mit Zeit und Budget
- Späte Einbindung in Projekte („Datenschutz by Reaktion“)
- Fehlende oder unvollständige Dokumentation
- Keine Schulung der Mitarbeitenden
Praxis-Tipp:
Binden Sie Ihren DSB frühzeitig in Projekte ein – vor allem bei der Einführung neuer Tools, Software oder Prozesse. So vermeiden Sie nachträgliche Datenschutzprobleme und unnötige Kosten.
5. Empfehlungen für DSBs und Unternehmen
Für Datenschutzbeauftragte
- Positionieren Sie Ihre Rolle sichtbar im Unternehmen.
- Bestehen Sie auf Einbindung in Entscheidungsprozesse – strategisch wie technisch.
- Bleiben Sie fachlich aktuell (z. B. durch jährliche Fortbildungen).
- Dokumentieren Sie Ihre Tätigkeit sorgfältig und nachvollziehbar.
Für Unternehmen
- Nehmen Sie die Rolle des DSB ernst – auch bei freiwilliger Benennung.
- Stellen Sie ausreichende Ressourcen und Unterstützung bereit.
- Fördern Sie eine Datenschutzkultur: Datenschutz ist Teamarbeit, kein Einzelprojekt.
- Integrieren Sie Datenschutz von Anfang an in neue Prozesse („Privacy by Design“).
Fazit: Datenschutz als Chance für Vertrauen und Sicherheit
Die Artikel 37 bis 39 DSGVO bilden die Grundlage für einen wirksamen Datenschutz im Unternehmen.
Sie definieren, wann ein Datenschutzbeauftragter erforderlich ist, welche Rechte er hat und welche Aufgaben er übernimmt.
Doch entscheidend ist die Umsetzung:
Nur wenn der DSB unabhängig, kompetent und gut eingebunden agieren kann, wird Datenschutz zur gelebten Praxis – und nicht zur bloßen Formalität.
Setzen Sie die gesetzlichen Vorgaben als Chance um:
für mehr Vertrauen, Sicherheit und Resilienz in Ihrem Unternehmen.
Häufige Fragen (FAQ)
Wann ist ein Datenschutzbeauftragter Pflicht?
Wenn regelmäßig mehr als 20 Personen automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten oder besondere Kategorien von Daten verarbeitet werden.
Kann der Geschäftsführer selbst Datenschutzbeauftragter sein?
Nein, das wäre ein Interessenkonflikt – die Funktion muss unabhängig ausgeübt werden.
Muss der Datenschutzbeauftragte geschult werden?
Ja, kontinuierliche Fortbildung ist Pflicht, um Fachkunde und Aktualität sicherzustellen.
Tipp zum Schluss: Datenschutz einfach dokumentieren
Die Arbeit eines Datenschutzbeauftragten erfordert strukturierte Dokumentation und laufende Schulungen.
Mit PLANIT // PRIMA können Sie Ihre Datenschutzprozesse einfach, effizient und rechtskonform organisieren – inklusive Mitarbeiterschulungen und Vorlagen.