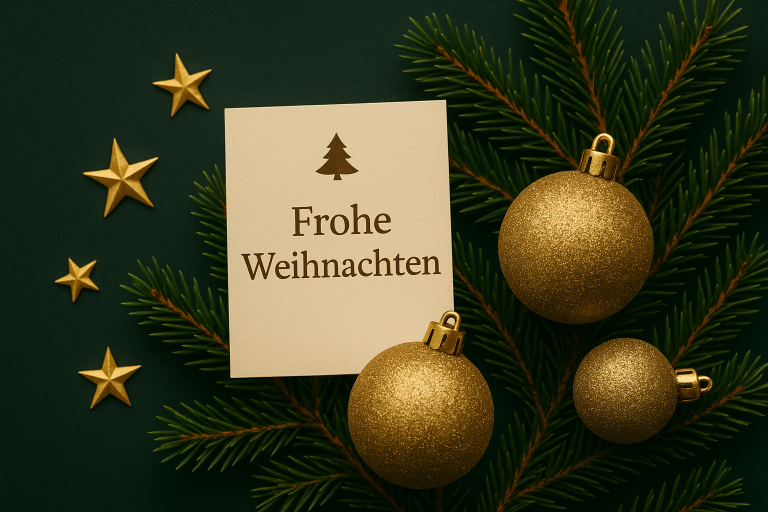Datenschutzbeauftragter Pflicht – diese Frage beschäftigt viele Unternehmen seit Inkrafttreten der DSGVO. Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind zahlreiche Organisationen verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu benennen. In Deutschland konkretisiert § 38 BDSG diese Pflicht zusätzlich und verschärft sie in manchen Fällen sogar.
In diesem Beitrag erfahren Sie, wann die Datenschutzbeauftragter Pflicht gilt, welche Kriterien dabei eine Rolle spielen und warum sich eine freiwillige Benennung oft auch wirtschaftlich lohnt.
Europäische Grundlage: Artikel 37 DSGVO
Nach Art. 37 DSGVO müssen Verantwortliche und Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benennen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- Behörden und öffentliche Stellen – mit Ausnahme von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit.
- Kerntätigkeit ist die regelmäßige und systematische Überwachung betroffener Personen in großem Umfang (z. B. Tracking, Scoring, Videoüberwachung).
- Kerntätigkeit ist die umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO (z. B. Gesundheits-, Biometrie- oder Religionsdaten) oder von Daten über strafrechtliche Verurteilungen nach Art. 10 DSGVO.
Diese Voraussetzungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten.
In der Praxis ist jedoch oft unklar, wann eine Verarbeitung als umfangreich oder regelmäßig gilt.
Auslegungshilfe: Erwägungsgrund 97 DSGVO
Der Erwägungsgrund 97 DSGVO liefert wichtige Orientierung:
Ein Datenschutzbeauftragter ist immer dann erforderlich, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit ist – insbesondere bei Überwachungstätigkeiten oder sensiblen Datenarten.
Gleichzeitig definiert der Erwägungsgrund auch die Anforderungen an den DSB:
- Unabhängigkeit in der Ausübung seiner Aufgaben
- Fachwissen im Datenschutzrecht und in der Praxis
- Keine Interessenkonflikte mit anderen Rollen
Damit wird klar: Der Datenschutzbeauftragte ist kein reiner Formalposten, sondern ein zentraler Bestandteil der Unternehmens-Compliance.
Nationale Ergänzung: § 38 BDSG
In Deutschland konkretisiert § 38 BDSG die DSGVO-Pflichten.
Dieser Paragraf erweitert die Benennungspflicht erheblich – besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Schwellenwert von 20 Personen
Nach § 38 Abs. 1 BDSG muss ein Datenschutzbeauftragter benannt werden, wenn regelmäßig mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind – unabhängig von der „Kerntätigkeit“.
Diese deutsche Besonderheit führt dazu, dass viele kleinere Unternehmen einen DSB benötigen, obwohl sie nach der DSGVO allein nicht dazu verpflichtet wären.
Weitere Pflichtfälle nach BDSG
Ein Datenschutzbeauftragter ist außerdem verpflichtend, wenn:
- eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35 DSGVO erforderlich ist,
- oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, anonymisierten Übermittlung oder Markt- bzw. Meinungsforschung verarbeitet werden.
Damit führt das BDSG zusätzliche risikobasierte Kriterien ein, die über die DSGVO hinausgehen.
Praxis: Was bedeutet „Kerntätigkeit“ oder „umfangreich“?
Begriffe wie regelmäßig, umfangreich oder Kerntätigkeit sind in der Praxis auslegungsbedürftig.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden orientieren sich an diesen Kriterien:
| Kriterium | Bedeutung |
|---|---|
| Zahl der Betroffenen | Je größer die Anzahl, desto eher „umfangreich“ |
| Art der Daten | Besonders schützenswerte Daten → Pflicht wahrscheinlicher |
| Dauer & Häufigkeit | Regelmäßige, nicht nur gelegentliche Verarbeitung |
| Zweck & Reichweite | Geschäftszweck oder überregionale Datenverarbeitung |
Beispiele aus der Praxis:
- Eine Gesundheits-App, die Nutzerdaten analysiert → DSB-Pflicht (sensible Daten, systematische Überwachung).
- Ein Onlinehändler mit Tracking und Profiling → DSB-Pflicht.
- Eine Steuerberatungskanzlei mit < 20 Mitarbeitenden → meist keine Pflicht, sofern keine DSFA erforderlich ist.
Freiwillige Benennung – strategisch oft sinnvoll
Selbst wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, kann die freiwillige Bestellung eines Datenschutzbeauftragten sinnvoll sein:
- Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Strukturierte Umsetzung der Datenschutzpflichten
- Höheres Vertrauen bei Kunden, Partnern und Behörden
- Bessere Vorbereitung auf künftige Unternehmensvergrößerung
Wichtig: Die Entscheidung gegen eine Benennung sollte dokumentiert und regelmäßig überprüft werden – insbesondere bei organisatorischen Änderungen oder Einführung neuer Technologien.
Haftung und Bußgelder bei Verstößen
Unternehmen, die entgegen der Pflicht keinen Datenschutzbeauftragten bestellen, riskieren Bußgelder bis zu 10 Mio. € oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes (Art. 83 Abs. 4 lit. a DSGVO, § 43 BDSG).
Diese Haftung trifft immer das Unternehmen, nicht den DSB persönlich.
Fazit: Datenschutzbeauftragter Pflicht – besser prüfen als riskieren
Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten ergibt sich aus:
- Art. 37 DSGVO (europäische Grundlage),
- Erwägungsgrund 97 DSGVO (Auslegung)
- und § 38 BDSG (deutsche Ergänzung)
Unternehmen sollten regelmäßig prüfen, ob sie unter diese Regelungen fallen und die Entscheidung transparent dokumentieren.
Ein bestellter Datenschutzbeauftragter ist kein bürokratisches Übel, sondern ein strategischer Compliance-Baustein, der Rechtssicherheit und Vertrauen schafft.
FAQ: Datenschutzbeauftragter Pflicht
Wann ist ein Datenschutzbeauftragter Pflicht?
Sobald mindestens 20 Personen personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten oder sensible Daten in größerem Umfang verarbeitet werden (§ 38 BDSG, Art. 37 DSGVO).
Wer haftet, wenn kein Datenschutzbeauftragter bestellt wird?
Das Unternehmen bzw. der Verantwortliche – Bußgelder bis zu 10 Mio. € oder 2 % des Jahresumsatzes sind möglich.
Gilt die Pflicht auch für kleine Unternehmen?
Ja, wenn 20 oder mehr Beschäftigte regelmäßig Daten verarbeiten oder eine DSFA notwendig ist.
Kann man freiwillig einen Datenschutzbeauftragten bestellen?
Ja – oft sinnvoll zur Stärkung der Compliance und als Signal an Geschäftspartner und Behörden.
Praxistipp
Ob Pflicht oder freiwillig: Eine saubere Datenschutz-Dokumentation ist immer erforderlich.
Mit PLANIT // PRIMA lassen sich gesetzlich vorgeschriebene Nachweise und Verzeichnisse effizient pflegen.