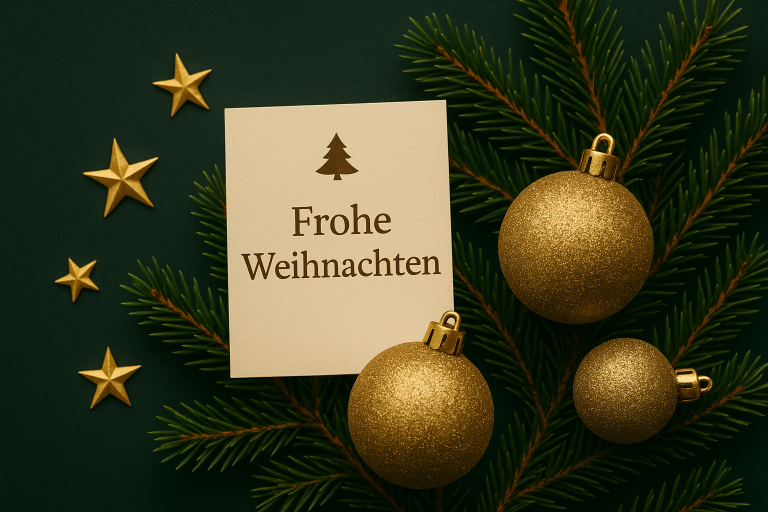Kündigung Datenschutzbeauftragter ist ein rechtlich komplexes und sensibles Thema für viele Unternehmen. Wer einmal einen Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellt hat, kann diese Person nicht ohne Weiteres wieder abberufen oder kündigen.
Insbesondere bei internen Datenschutzbeauftragten gelten strenge Schutzregelungen, die Arbeitgeber kennen müssen, um rechtliche Risiken zu vermeiden.
Dieser Beitrag erklärt praxisnah, wann eine Kündigung überhaupt zulässig ist, welche Unterschiede zwischen internen und externen DSB bestehen – und welche Fehler in der Praxis häufig passieren.
Kündigung Datenschutzbeauftragter – interne DSB nur aus wichtigem Grund
Wird ein Mitarbeitender zum Datenschutzbeauftragten bestellt, greift der besondere Kündigungsschutz nach § 6 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Vorschrift ist eindeutig:
Eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, solange die Person als Datenschutzbeauftragter tätig ist – und sogar noch ein Jahr danach.
Das bedeutet:
Eine Kündigung kann nur außerordentlich und fristlos erfolgen, wenn ein wichtiger Grund im Sinne von § 626 BGB vorliegt.
Zulässig ist sie also nur, wenn die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar wäre.
Beispiele für wichtige Gründe
- Grobe Pflichtverletzungen (z. B. Verletzung der Verschwiegenheitspflicht)
- Gravierende Interessenkonflikte (z. B. gleichzeitige Tätigkeit als IT-Leiter oder Geschäftsführer)
- Dauerhafter Verlust der Fachkunde
- Nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses
Nicht ausreichend sind dagegen betriebsbedingte Gründe wie Umstrukturierungen, Abteilungsauflösungen oder Kostendruck.
Das hat das Landesarbeitsgericht Nürnberg (Urteil vom 19.02.2020, 2 Sa 274/19) ausdrücklich bestätigt.
Abberufung vs. Kündigung
Oft wird verwechselt, dass die Abberufung als Datenschutzbeauftragter automatisch auch die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedeutet – das ist nicht der Fall.
Merke:
- Abberufung beendet die Funktion als DSB. Sie darf nur erfolgen, wenn sachliche Gründe vorliegen (Art. 38 Abs. 3 DSGVO).
- Kündigung betrifft das Arbeitsverhältnis – sie ist nur außerordentlich möglich (§ 6 Abs. 4 BDSG i. V. m. § 626 BGB).
- Der Kündigungsschutz wirkt 12 Monate nach Abberufung fort.
Damit schützt der Gesetzgeber die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten – damit dieser seine Aufgaben ohne Angst vor Repressalien wahrnehmen kann.
Auch in der Probezeit geschützt
Selbst während der Probezeit besteht der besondere Kündigungsschutz.
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 05.05.2022, 2 AZR 225/20) stellte klar:
Ein Arbeitgeber darf einen bestellten Datenschutzbeauftragten nicht ordentlich kündigen, auch nicht in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses.
Beteiligung des Betriebsrats
Ist im Unternehmen ein Betriebsrat vorhanden, muss dieser vor jeder Kündigung angehört werden (§ 102 BetrVG).
Ohne diese Anhörung ist die Kündigung unwirksam – auch bei Datenschutzbeauftragten.
Externer Datenschutzbeauftragter – Vertragsende & Kündigung richtig gestalten
Bei externen Datenschutzbeauftragten gilt eine andere Rechtslage:
Sie sind in der Regel nicht angestellt, sondern auf Grundlage eines Dienstleistungsvertrags tätig.
Daher findet das Arbeitsrecht – und damit auch der besondere Kündigungsschutz aus § 6 Abs. 4 BDSG – keine direkte Anwendung.
Hier kommt es auf den Vertrag an.
Was der Vertrag regeln sollte
Ein klarer Dienstleistungsvertrag ist entscheidend, um spätere Konflikte zu vermeiden. Empfehlenswert sind Regelungen zu:
- Kündigungsfristen und Abberufungsgründen
- Vertraulichkeit und Haftung
- Vertretungs- und Erreichbarkeitsregelungen
- Umgang mit Interessenkonflikten
- Übergabe- und Löschkonzept bei Vertragsende
Fehlt eine vertragliche Regelung, gelten die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 611 ff. BGB) über Dienstverhältnisse.
Grenzen der Vertragsfreiheit
Trotz Vertragsfreiheit sind Unternehmen nicht völlig frei in ihrer Entscheidung:
Artikel 38 Abs. 3 DSGVO verbietet ausdrücklich, einen Datenschutzbeauftragten wegen der Erfüllung seiner Aufgaben zu benachteiligen oder abzuberufen.
Das bedeutet:
Eine Kündigung darf nicht erfolgen, weil der DSB datenschutzrechtliche Verstöße aufgedeckt oder Kritik geäußert hat.
Ein solches Verhalten wäre ein Verstoß gegen die DSGVO und kann Bußgelder oder Schadensersatzforderungen nach sich ziehen.
Rechtsprechung: Klare Signale der Gerichte
Die Gerichte betonen seit Jahren, dass der besondere Schutz nicht leicht zu umgehen ist.
Das LAG Nürnberg (2020) entschied:
Ein Unternehmen darf keinen internen DSB einfach durch einen externen ersetzen, nur um den Kündigungsschutz zu umgehen – ein solcher Austausch ist rechtswidrig.
Auch das Bundesarbeitsgericht (2022) stellte klar:
Betriebliche Umstrukturierungen reichen nicht aus, um den besonderen Schutz auszuhebeln. Entscheidend ist, ob ein wichtiger Grund im Sinne von § 626 BGB vorliegt.
Praktische Tipps: Kündigung Datenschutzbeauftragter rechtssicher umsetzen
1. Sorgfältige Auswahl & Vertragsgestaltung
Prüfen Sie bei internen DSBs mögliche Interessenkonflikte und dokumentieren Sie die Fachkunde.
Bei externen DSBs ist ein detaillierter Vertrag unverzichtbar.
2. Dokumentation der Kündigungsgründe
Eine außerordentliche Kündigung muss objektiv begründbar sein.
Dokumentieren Sie alle relevanten Vorkommnisse sorgfältig.
3. Klagefristen beachten
DSBs müssen innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Klage beim Arbeitsgericht einreichen (§ 4 KSchG).
Nach Ablauf der Frist gilt die Kündigung als wirksam – selbst wenn sie unzulässig war.
4. Aufsichtsbehörden im Blick behalten
Gemäß § 40 Abs. 6 BDSG kann die Datenschutzaufsichtsbehörde die Abberufung eines ungeeigneten DSB verlangen – etwa bei mangelnder Fachkunde oder Interessenkonflikten.
5. Keine „Scheinkündigungen“
Das bloße Entziehen von Aufgaben bei gleichzeitiger Weiterbeschäftigung gilt als faktische Kündigung – und kann gerichtlich angegriffen werden.
FAQ zur Kündigung Datenschutzbeauftragte
Wann darf ein interner Datenschutzbeauftragter gekündigt werden?
Nur außerordentlich und fristlos – bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (§ 626 BGB).
Gilt der Kündigungsschutz auch in der Probezeit?
Ja. Das hat das Bundesarbeitsgericht 2022 ausdrücklich bestätigt.
Kann der IT-Leiter Datenschutzbeauftragter sein?
In der Regel nein, da ein Interessenkonflikt besteht.
Darf ein Unternehmen einfach von intern auf extern wechseln?
Nicht, wenn dies allein dem Zweck dient, den Kündigungsschutz zu umgehen.
Fazit: Kündigung Datenschutzbeauftragter nur mit Sorgfalt und Weitsicht
Die Kündigung eines Datenschutzbeauftragten ist ein rechtlich heikles Unterfangen – sowohl arbeitsrechtlich als auch datenschutzrechtlich.
Während interne DSBs durch § 6 Abs. 4 BDSG besonders geschützt sind und nur bei einem wichtigen Grund außerordentlich gekündigt werden dürfen, genießen externe Datenschutzbeauftragte zwar vertragliche Flexibilität, stehen aber dennoch unter dem Schutz der DSGVO.
Wer rechtssicher vorgehen will, sollte:
- Verträge klar regeln,
- Dokumentation sauber führen,
- Fristen und Anhörungspflichten beachten,
- und im Zweifel rechtlichen Rat einholen.
So vermeiden Sie arbeitsgerichtliche Auseinandersetzungen – und schützen zugleich die Integrität Ihrer Datenschutzorganisation.